Wie Pokémon unsere Kindheit geprägt hat
Alles beginnt mit einem positiven Schnelltest. Während die Quarantäne am Himmel aufzieht und ein Symptomgewitter seine Schatten vorauswirft, versinkt die Freiheit der gerade angebrochenen Semesterferien am Horizont. Schon nach wenigen Tagen der häuslichen Isolation kenne ich nur noch eine Wetterlage: Langeweile. Während zu Beginn noch allerlei Symptome überwunden werden mussten, ist die Zeit nun ins Stocken geraten. Genauso wie mein Tun. Denn Bücher zu lesen fühlt sich in der ersten Woche der Semesterferien einfach nicht richtig an und auch Netflix hat seinen Charme nach einem Tag Binge-Watching verloren. Und doch beweist sich dieses Vakuum als Idealbedingung für einen Kreativitätsknall. Ich erinnere mich an ein kleines Gerät, nicht größer als 13 mal 14 cm. Ein schneller Griff zur Maske und schon wage ich den Sprung auf den Dachboden. Nach kurzer Suche ist das Objekt der Begierde schnell gefunden. Der Nintendo-DS. In einer adäquaten Tasche verpackt kommt er erstaunlich gut daher für sein Alter. Zwar scheint besonders der A-Knopf in ferner Vergangenheit schon einmal bessere Tage erlebt haben. Aber alles in allem wirkt das Gerät auch nach 15 Jahren noch spielfähig. Langsam wende ich den dunkelschwarzen Begleiter meiner Kindheit. Mit einem leichten Tippen berühre ich die Spielkarte. Erstaunlich nervös. Langsam bewegt sie sich aus dem Slot heraus. Und schon lässt sich der blau umrandete gelbe Schriftzug erkennen: Pokémon.
Die Pokémon-Spiele gehören zu den erfolgreichsten Games weltweit. In meiner Generation ist gefühlt niemand aufgewachsen, ohne Pikachu zu kennen – und zu trainieren. Dabei gehört Pokémon noch zu einem Typ Game, das vor dem Internet angesiedelt ist. 1996 in Japan erschienen, schafften es die ersten beiden Spiele 1999 nach Europa. Der Grundaufbau ist dabei ziemlich einfach: Mit einem Starter-Pokémon ausgestattet zieht man als Pokémon-Trainer durch die Welt, fängt neue Pokémon, besiegt andere Pokémon-Trainer und soll dabei nebenher als unbezahlter Hiwi für einen Pokémon-Professor bestmöglich noch den Pokédex vervollständigen, eine Art Enzyklopädie der Pokémon. Aber eigentlich hat man selbst vor allem ein Ziel: Pokémon-Meister zu werden.
„I wanna be the very best“ eben. Auch die Melodie dieser Leitthese des Games kennt in meiner Generation annähernd jede*r. Denn das erste Intro des Pokémon-Franchise ist weltberühmt. Dazu dann noch „Gotta catch them all“ und schon sind nicht nur die zwei Ziele des Pokémon-Universums vertont, sondern auch zahlreiche Ohrwürmer in die Welt gesetzt. Viel ‚catchier‘ fand ich aber immer den Song ‚Pokémon Jotho‘ der zweiten Staffel, eine Art ‚Semi-Charmed Life‘ für Kinder. Hier gruben sich die Ohrwürmer in meiner Kindheit besonders tief. Erinnerungen an lange Nachmittage vor dem Fernseher oder lange Nächte unter der Bettdecke mit der Konsole stellen sich unverzüglich ein. Umso nostalgischer blickt man darauf zurück, wenn man sich auf Spotify die Songs der neueren Staffeln zu Gemüte führt und dabei stellenweise Helene Fischer ähnliche Melodien am Ohr abperlen. Ohrwürmer haben hier schlechten Boden.
Ganz manuell starte ich den DS über einen Schieber an der Seite. Trotz eines Jahrzehnts Pause verweigert der Akku seinen Dienst nicht. Über den Touchscreen wähle ich das Pokémon-Spiel aus. Den etwas modrigen Dachboden habe ich längst vergessen. Dann drei Glockenschläge. Nicht vom benachbarten Kirchturm, sondern aus dem Nintendo DS. Mit dieser akustischen Ankündigung fliegt mir aus der aufgehenden Sonne ein Pokémon entgegen. Gefolgt von zahlreichen Gesichtern, Städten und Taschenmonstern. Und unterlegt von einer sprunghaft-unharmonischen Musik.
So weltbekannt Pokémon ist, so wenig globale Spielgemeinschaft stiftet das Game. Denn als Spiel vor dem Internet-Zeitaler war Pokémon zu Beginn vor allem ein Single-Player-Game. Im Gegensatz zu den neueren Versionen und einem Großteil der Online-Spiele konnte Pokémon ‚asozial‘ gespielt werden – nicht im Sinne fehlender Rücksichtnahme oder mangelnden Sozialverhaltens, sondern im Sinne des Spielens ohne Gegen- und Mitspieler. Der Titel eines Pokémon-Champs kann erspielt werden, ohne mit anderen Spielern zu kooperieren oder konkurrieren. Mitspieler und Gegenspieler sind ‚tot‘, digital entpersonalisiert. Das ist zentral für Gaming insgesamt: Definierte der Spielwissenschaftler Johan Huizinga Mitte des 20. Jahrhunderts das analoge, „soziale Spiel“,1 machte es die Digitalisierung möglich, auch ganz zurückgezogen, ohne irgendwelche anderen zu spielen. Eine fundamentale Neuerung in 5000 Jahren Spielgeschichte. Auch wegen diesem Unterschied erscheint es mir sinnvoll, das herkömmliche (analoge) ‚Spiel‘ vom (digitalen) ‚Game‘ zu unterscheiden.
Allerdings baute Pokémon die körperliche Kopräsenz der Spieler noch in das Spielprinzip mit ein: Mit Freunden in der Nähe konnte (mit Hilfe eines Linkkabels) getauscht und gekämpft werden. Präsentische Formen des Spielens waren also in Pokémon noch weitaus stärker integriert als in den heutigen MMOs, Egoshootern, usw. Und auch noch an ein paar anderen Punkten unterscheidet sich Pokémon von vielen anderen Games. Das Spiel speicherte nicht automatisch. Vielmehr fiel dem Spieler diese Aufgabe zu. Das war ein Mechanismus, der im Game neue Möglichkeiten eröffnete und Wiederholbarkeit etablierte, aber auch nur einen Spielzustand zuließ. Wollte man das Game nochmal von vorne spielen, musste man die alten Erfolge löschen. Das ermöglichte jedoch ebenso eine höhere Komplexität des Games, weil mit Unterbrechungen gespielt werden konnte. Es gab einen Spielzustand, auf den zurückgekommen werden konnte. Das war bei Brettspielen wie ‚Risiko‘ nie möglich – oder jedenfalls nur unter dem Risiko, dass irgendjemand unerlaubte Truppenverschiebungen und -erweiterungen vornahm. Ohne Vertrauen zum Gegenspieler blieb nur die Option, die umkämpfte Weltkarte in neutralem Freundesgebiet zu verwahren oder auf Schritt und Tritt mitzuführen, ganz so wie Newman und Kramer in der US-Sitcom ‚Seinfeld‘.

Das Objekt der Begierde: Der Nintendo DS Light
Die Speicherkarte hatte auch ihre Schattenseite. Denn so korrekturoffen moderne Games sind, so updatebezogen gerade Online-Games sich generieren, natürlich nur, um möglichst viel Geld aus dem einzelnen Game zu holen, so korrekturavers war Pokémon. War ein Bug einmal eingebaut, konnte er nie mehr ausgemerzt werden. Korrekturoffenheit und Zukunftsoffenheit korrelieren eben. Bei Pokémon werden zwar immer wieder neue Games veröffentlicht, die Verbesserungen einpflegen und neue Spielchancen eröffnen. Aber die alten Games bestehen fort. Und deren sogenannte ‚Glitches‘ hervorrufende Fehler sind zahlreich.
Zu Bewusstsein komme ich im eigenen Zimmer. Genauer: mein digitales Alter Ego. Wie in jedem Pokémon-Spiel startet man wohlbehütet im mütterlichen Haus. Wenig später steht dann schon die erste Entscheidung an. Eines von drei Starter-Pokémon darf mit auf die Reise genommen werden. Zur Auswahl stehen ein feuergestachelter Igel, ein niedliches Krokodil und ein blattbewachsenes Etwas. Pros und Cons wabern durch die stickige Dachbodenluft. Nach langem Überlegen entscheide ich mich für den niedlichen Igel. Aber diese Entscheidungsprobleme werden maßgebend bleiben für mein Corona-Abenteuer. Denn wer schon bei der Essensbestellung scheitert, ist mit der Kuratierung eines sechsköpfigen Teams aus 493 Pokémon heillos überfordert. Dabei habe ich noch Glück, dass das Game über 12 Jahre alt ist. Die neuesten Pokémon-Spiele haben nämlich, Stand heute, 908 Pokémon. Dagegen sind die 30 Gerichte auf der Menükarte ein entscheidungstheoretisches El Dorado. Mit viel Planung, wie es sich für einen studentischen Schlafanzug-Abenteurer gehört, bereite ich deshalb meine Reise vor. Noch nicht einmal aus der Heimatstadt Neuborkia ausgezogen, greife ich schon zum Smartphone. Nach wenigen Klicks bin ich fündig: die Seite ‚Pokéwiki‘ zeigt mir eine Auswahl von Pokémon, die ich in den nächsten Stunden fangen könnte.
Kennzeichnend für Pokémon ist die Community, die sich um das ganze Franchise aufbaut. Sie tauscht sich dabei nicht nur in Foren aus, sondern erstellt Ordnungen: Leitfäden, Podcasts, Bilder, Artikel, digitale Pokédex-Einträge, Wikis. Gaming zieht also eine Reihe weiterer Kulturproduktion nach sich. Ganz Ähnliches lässt sich übrigens auch für andere Games oder die Fantasy-Literatur finden. Dabei glänzen die ‚Pokéasten‘ nicht nur mit Detailwissen, sondern auch Theorien zur Pokémon-Welt.2 Wissenschaftliche Theorie zu Pokémon gibt es aber kaum. Die Forschung befindet sich hier im gleichen Zustand wie die zum Film Anfang der 1920er Jahre: Es sind vor allem Selbstbeschreibungen der Praktiker*innen, ergo Spielentwickler*innen und Fans, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Den Film musste sich die Wissenschaft erst schrittweise einverleiben und eine eigene Disziplin ausbilden. Gleiches galt und gilt für die Game Studies.3 Und in gewisser Weise auch für eine ‚Pokémon-Theorie‘. Theoriegenese bei Kulturprodukten – das ist meistens der Weg von den Praktiker*innen zu den Theoretiker*innen.
Lange klicke ich mich von Pokémon zu Pokémon. Annähernd alle scheinen es mir Wert, in mein Team aufgenommen zu werden. Der Erkenntnisgewinn der digitalen Taxonomien taxiert für mich dementsprechend gegen Null. Konsterniert suche ich nach einer neuen Entscheidungshilfe. Und werde auf Netflix fündig. Denn vielleicht muss ich einfach nur ein paar Pokémon in Aktion sehen. Also öffne ich den nächsten Tab, logge mich ein und starte mit der ersten Folge der ersten Staffel: ‚Pika-Pikachu‘.
Die unendlich vielen Wiki-Seiten der Pokémon-Community sind bitter nötig. Pokémon ist ein komplexes Thema. Es gibt aktuell 23 Filme, 24 Staffeln und ca. 35 Editionen. Wenn sich eine Erzählung über so viele verschiedene Medien erstreckt, spricht man in der Forschung oft von ‚transmedialem Storytelling‘. Unter diesem Begriff wird dann versucht, die Kontinuitäten und Brüche zwischen den verschiedenen Bereichen eines Franchises unter die Lupe zu nehmen. Zusammengehalten wird das Pokémon-Universum dabei von den Protagonisten und den Pokémon. Und natürlich dem Verkaufszusammenhang.
Im Falle von Pokémon sind die Erzählweisen erstaunlich medienspezifisch. So wird in den Filmen die Freundesgruppe um den Protagonisten Ash in ein weltbestimmendes Ereignis hineingezogen. Gibt es zum Start meist eine vom jeweiligen Theme-Song unterlegte Kampf- oder Wettbewerbsszene, gefolgt von einem Fest, geht es danach schnell zur Sache. Ash, Pikachu und Konsorten müssen eingreifen, um die von bösen Verbrechern gestörte natürliche Ordnung wiederherzustellen. Störung heißt dabei: die Verbrecher wollen ein legendäres, d.h. besonders seltenes, teilweise einzigartiges Pokémon ausnutzen. Und mit dieser gestörten Ordnung geht immer eine Bedrohung für die gesamte Natur, Zivilisation oder Stadt einher. Dafür argumentiert jedenfalls der Kulturwissenschaftler Jason Bainbridge.4 Das gilt auch für einen Teil der Filme, beispielsweise den zweiten Film um das legendäre Lugia und die drei legendären Vögel Lavados, Zaptos und Arktos. Aber für eine Reihe von Filmen zeigt sich eine zweite Erzählstruktur, in der nicht Verbrecher, sondern abnormale oder außerweltliche Pokémon die Störung hervorrufen. Da ist das extraterrestrische Pokémon Deoxys, das geklonte Pokémon Mewtu, die außerhalb von Raum und Zeit stehenden Palkia und Dialga oder das vor der Welt stehende, weil diese erschaffende Arceus. Auch in diesem zweiten Erzählmuster trägt manipulatives menschliches Verhalten zur Konflikteskalation bei. Aber das natürliche Gleichgewicht wird nicht explizit durch den Menschen ins Wanken gebracht.
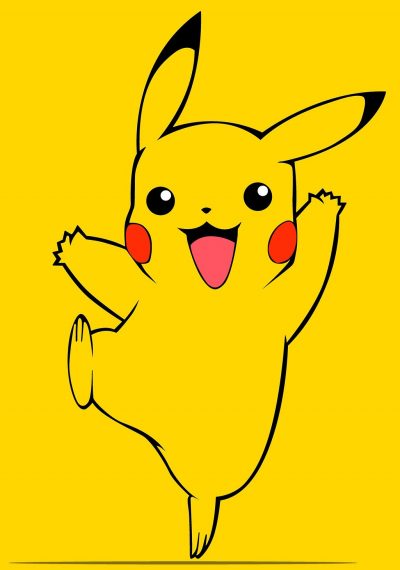
Pikachu, die bekannteste Maus der Welt
Natürlich schafft es die Heldengruppe um Ash immer, die Verbrecher zu besiegen, die illegitim gefangenen legendären Pokémon zu befreien bzw. befrieden und damit Harmonie wiederherzustellen. Am Ende des Films ist dann wieder fast alles wie zu Beginn. Sogar derart, dass die Protagonisten im 1. Film sogar alle Ereignisse vergessen. Umso besser kann dann im nächsten Film die gleiche Story mit neuen Pokémon aufs Neue erzählt werden.
Die Serie erzählt demgegenüber eher wie ein Abenteuerroman. Der Protagonist Ash zieht, noch im Kindesalter, in die Welt aus, um gemeinsam mit seinen Pokémon Abenteuer zu bestehen und Pokémon-Meister zu werden. Begleitet wird er von den jeweils gleichen Personen wie in den Filmen, auch wenn das Figurenarsenal um Ash mit verschiedenen Generationen an Pokémon wechselt. Einzig der notorisch notgeile, aber doch schüchterne und erfolglose Frauenschwärmer Rocko kann sich zu Beginn noch einige Jahre halten. Die großen Entwicklungslinien fehlen, sodass die Abenteuer meistens episodisch bleiben. Davon ausgenommen sind nur die Pokémon, die sich weiterentwickeln können. Die Protagonisten werden jedoch nicht einmal älter. Dadurch können mit jeder neuen Generation in einer neuen Region ähnliche Abenteuer erzählt werden. Wie im Film ist das Erzählen unendlich wiederholbar Im Unterschied zu diesem werden in der Serie allerdings die genuinen, aber weniger gewichtigen Vorhaben des Protagonisten, der seine Route selbst wählt, auf die Leinwand gebracht.
Das Game verbindet nun beide Erzählstränge. Jedes Spiel erzählt eine unterschiedliche Geschichte mit einem anderen legendären Pokémon, einer anderen Verbrecherorganisation und einer neuen großen Bedeutung. Dahin gilt es sich aber erst schrittweise vorzuarbeiten und seine Pokémon, ganz wie in der Serie, zu trainieren und letztlich Pokémon-Meister zu werden.
Nachdem ich mich endlich ins hohe Gras wage, nimmt die Story schrittweise Fahrt auf. Die ersten Arenaleiter besiege ich locker-lässig noch im Pyjama-Look. Meine Angewohnheit, jedes wilde Pokémon zu besiegen, anstatt aus dem Kampf zu fliehen, verstümmelt die Gegner zu Makulatur. Auch das Verbrechersyndikat ‚Team Rocket‘ schlage ich schrittweise zurück. Wollten sie zuvor noch mit den Ruten des Pokémon Flegmon handeln, unterbinde ich wenig später, dass sie zahlreiche Voltoball als Energiequelle ausnutzen. Einmal wie der große Held fühlen. Und das, obwohl mein Alter Ego genauso wie Ash zarte zehn Lenzen hat. Mit umso mehr jugendlichem Enthusiasmus besiege ich Trainer*in um Trainer*in.
Die Helden im Pokémon-Universum, sei es im Film, der Serie oder den Games, sind stets Kinder. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass Pokémon vor allem Kinder ansprechen und als Konsumenten gewinnen will. Eine sehr funktionale Perspektive, aus der Kinder betrachtet werden. Als Händler nehmen sie eine weitere ökonomische Rolle ein, nicht nur im Game, sondern vor allem im Pokémon-Sammelkartenspiel. Auch ich habe in meiner Kindheit für Pokémon-Karten mehr Geld ausgegeben als in fünf Jahren Studium für Bier und Bücher. Aber anstatt die Karten als langfristige Wertanlagen zu betrachten, verkaufte und verschenkte ich sie mit Beginn der Pubertät. Ein kapitaler Fehler, denn manche Pokémon-Karten haben heute einen Wert, der selbst Horst Lichter bei ‚Bares und Rares‘ in Schnappatmung verfallen lassen würde. Kinder sind eben doch nicht die klügsten Trader.
Dass alle Helden in Pokémon kindliches Alter haben, passt aber noch ganz anders zur Spätmoderne. Zwar sind die anderen Pokémon-Trainer oft ebenso jung. Die Arenaleiter und Verbrecher jedoch sind erwachsen. Kinder werden folglich zu Helden, die für Natur und Umwelt gegen eine korrupte Erwachsenenwelt eintreten. Verblüffend ähnlich zur aktuellen Klimabewegung.
Dabei treten die Kinder für die Rettung einer Natur ein, in der Pokémon harmonisch zusammenleben. Es gibt keinen Kampf ums Überleben, und auch wenn legendäre Pokémon sich hin und wieder mal in die Haare bekommen, leben sie doch unproblematisch nebeneinander, solange sie sich aus dem Weg gehen und nicht zum Kampf aufgestachelt werden. Das ist durchaus ein Unterschied zur realen Tierwelt: Hier gibt es ökologische Gleichgewichte, aber keine friedliche Koexistenz aller Lebewesen. Harmonisch ist auch das Zusammenleben von Mensch und Pokémon. Drachenpokémon wie Glurak brennen im Unterschied zu so ziemlich jeder anderen Erzählung keine Städte nieder und werden im Gegenzug auch nicht systematisch verfolgt. Mensch und Monster, denn nichts anderes sind die ‚Pocket Monsters‘, gefährden sich nicht. Dieses friedliche Nebeneinanderleben kann nun zu einem freundschaftlichen Miteinanderleben sublimiert werden. Pokémon und Mensch gehen einen Bund ein: das Trainerverhältnis. Das betonen auch die Pokémon-Songs. „Arm in arm, we’ll win the fight“ und „You’re my best friend, in a world we must defend“, heißt es im ‚Pokémon-Theme’ und der Song mit dem Titel ‚Together Forever‘ stilisiert das dann fast in Ehe-Semantik. Dabei ist besonders die Prozesshaftigkeit dieser Beziehung relevant. Nicht nur, weil Pokémon sich entwickeln und gemeinsam mit dem Trainer wachsen. Vielmehr wird erst im Prozess des Pokémon-Fangens diese Beziehung möglich. Das Pokémon wird von Natur zu Kultur transformiert, man könnte auch sagen ‚domestiziert‘. Unter Rückgriff auf den schottischen Philosophen John Locke ließe sich genau dies als Arbeit verstehen.5 Und Arbeit legitimiert bzw. kreiert Eigentum. Signum hierfür ist der Pokéball, der als technisches Utensil der Arbeit nicht nur während des Fangens zentral ist, sondern auch legitimes Eigentum symbolisiert. Genau das Gegenteil praktizieren die Verbrecher, die Pokémon stehlen, unterjochen und in Käfige einsperren.
Das alles wirkt zwar wie ein Aneignungs- und Unterwerfungsprozess, aber beide Seiten gehen ihn bereitwillig ein. Insofern wird im Kampf mit dem Pokémon Kongruenz hergestellt. Die Interessen werden abgeglichen,6 Trainer und Pokémon erweisen sich gegenseitig als würdig. Passung statt Durchsetzung von Machtpositionen steht im Vordergrund.
Züge eines Freundschaftsverhältnisses bilden sich zudem auch zwischen Gamer und Pokémon aus. Denn Pokémon wird umso mehr gespielt, je zugehöriger man sich zu den Teammitgliedern fühlt7 – und auch umgekehrt steigt das Zugehörigkeitsgefühl, wenn gemeinsam mit dem Team mehr erlebt wird. Ähnliche Ergebnisse gab es bereits für digitale Haustiere wie den Tamagotchi.
Langsam merke ich, dass ich meine Kindheit hinter mir gelassen habe. Die Immersion des Spiels zieht sich zugunsten der Erkenntnis zurück, dass ich mich gar nicht mehr auf dem Dachboden, sondern im Bett befinde. Und dass ich nach einer seinesgleichen suchenden Gamer-Leistung fast schon am Ende des Abenteuers angelangt bin. Die letzten Meter sind bekanntlich die schwersten, weil die Füße müde werden, zumal, wenn man von Kindesbeinen an unterwegs ist. Und in den Pokémon-Games gibt es nur zwei Transportmittel: eben diese Füße oder das Fahrrad. Wäre auch unverantwortlich, einen zehnjährigen hinter das Steuer zu setzen. Also schleppt sich mein Alter Ego durch die letzte Arena. Nur um wieder in den Anfangsort zurückkehren zu müssen. Aus Faulheit schwinge ich mich auf mein Tauboss und fliege, ganz emissionsfrei. Professor Lind, von dem ich zu Beginn mein Starter-Pokémon erhielt, hat dieses Mal eine noch größere Überraschung parat. Ich erhalte einen Meisterball, mit dem jedes Pokémon ohne Widerstand gefangen werden kann. Das passt mir jetzt ganz gut, will ich doch nicht lange um den heißen Brei herumkämpfen, sondern direkt den K.O.-Schlag landen.
Der Meisterball ist das Gegenteil dieses Interessenabgleichs. Dementsprechend gibt es ihn in Serie und Film eigentlich nicht. Und auch im Game ist er auf ein Exemplar limitiert, denn das Spielprinzip – Pokémon im Kampf schwächen und dann Pokébälle einsetzen, bis der Zufallsgenerator sich für ein positives Ergebnis entscheiden hat – wird von ihm unterlaufen. Der Meisterball steht damit auch für ein anderes Verhältnis zwischen Mensch und Pokémon. Er symbolisiert Beherrschung und Erfolgsgarantie. Und so lässt sich die gesamte Pokémon-Welt auch anders lesen: Pokémon werden nicht nur von Verbrechern misshandelt, sondern systematisch unterdrückt; beim Fangen werden sie überwältigt und geschwächt; sie sind im Pokéball Eigentum des Trainers, der mit ihnen machen kann, was er will und sie in einen Hahnenkampf mit anderen Pokémon schickt, in denen er die Befehle erteilt und die Pokémon die Wunden von Feuer und Krallen erleiden müssen; Kommunikabilität existiert nur uni-direktional, vom Trainer an das Pokémon, das zwar zurückblaffen, aber nicht gegenargumentieren kann. Die Songs bringen dieses Besitzverhältnis prägnant zum Ausdruck: „Learn the way, to take command / Use the power that’s in my hand“.
Dieses Ausnutzen der Pokémon ist für den Menschen folgerichtig. Er erweitert hiermit seine Fähigkeiten. So kann im Game mit Hilfe der Pokémon gesurft, geflogen und geklettert werden. Auch die Attacken der Pokémon gehen über Fähigkeiten des Menschen hinaus, der bekanntlich weder Feuer speien noch Wasser werfen kann. Ganz nach Sigmund Freud sind Pokémon die Prothesen des „Prothesengottes“ Mensch.8 Nur dass die Prothesen dieses Mal eben nicht Maschinen, sondern Lebewesen sind.
Diese zweite Lesart mag dem Grundton des Storytellings entgegenstehen, ganz von der Hand zu weisen ist sie nicht. Allerdings resultieren solche antagonistische Momente auch daraus, dass Pokémon zunächst als Game entwickelt wurde, um das sich dann andere Elemente des Franchises anlagerten. Und das Game hat eben, ganz computerspieltypisch, eine Kampf- und Abenteuerstruktur.
Pokémon entwirft somit ein Idealbild des Zusammenlebens von Mensch und Tier, impliziert die Schattenseiten aber stets mit und verschweigt sie manchmal. Im Gegensatz zur Realität, in der Nutztierverhältnisse insbesondere in der Lebensmittelproduktion überwiegen und Freundschaftsverhältnisse auf glückende Haustierbeziehungen beschränkt bleiben – wobei wohlgemerkt auch dies ein Eigentumsverhältnis darstellt, in das sogar die Entscheidungsmacht über Leben und Tod des Tieres inkludiert ist–, gibt es in Pokémon eine Form des Zusammenlebens, in der sich Natur angeeignet werden kann, ohne sie unterjochen und ausbeuten zu müssen. Folgeprobleme wie Umweltzerstörung treten nur auf, wenn Verbrecher auf anachronistische Mittel zurückgreifen. Damit können nicht nur Mensch und Pokémon, sondern auch Hochtechnologie und Urnatur parallel existieren.

Friedliches Zusammenleben: Miteinander lachen statt einander fressen
Dass Mensch-Tier-Verhältnisse immer stärker in den Fokus treten, zeigt sich nicht nur in der Ethik, die sich mit dieser Frage immer intensiver auseinandersetzt. Auch die Populärkultur stellt immer öfter Menschen und Tiere gemeinsam dar. Zugegebenermaßen gibt es Tierfabeln schon seit Äsop, die Märchenliteratur strotzt nur so von Wölfen, Schwänen und Eseln und auch im Mittelalter werden Mensch und Tier zu Partnern, wie ein Löwe und der Ritter Iwein in Hartmanns von Aue gleichnamigem Artusroman. In letzter Zeit werden diese Verhältnisse jedoch immer expliziter auch vor dem Hintergrund des Zusammenlebens thematisiert. Sei es in Pokémon, dem Harry Potter-Prequel ‚Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind‘, der Netflix-Serie ‚The Witcher‘ und vielem mehr.
Statt von Tieren würden wir bei vielen dieser Erzählungen wahrscheinlich eher von ‚Monstern‘ sprechen. Und auch bei Pokémon sollte die Parallele zu Tieren nicht überinterpretiert werden, denn ihre Vorlage bilden in vielen Fällen nicht reale Lebewesen, sondern die yōkai, mythische japanische Wesen, um die sich ganze Enzyklopädien, Erzählungen und Bildreihen ranken. Die Ähnlichkeiten sind teilweise frappierend augenscheinlich und nicht nur in der Forschung9, sondern auch YouTube-Videos und Blog-Beiträgen ausführlich dokumentiert. Daneben kongruieren yōkai und Pokémon in ihren Fähigkeiten. Und der Japanologe Michael Dylan Foster hat zudem darauf hingewiesen, dass beide Sphären von starken Ordnungstendenzen geprägt sind. Legten die Menschen in Japan früher Enzyklopädien, Kataloge und Erzählbände über yōkai an, übernimmt im Pokémon-Universum der Pokédex diese Aufgabe.10 Das alles ist wichtig, um Pokémon nicht vor dem Hintergrund westlicher Monstertheorien zu analysieren. Sich mit Pokémon auseinanderzusetzen heißt, sich aus dem eigenen Kulturkreis herauszubewegen.
Ein Höhepunkt jeden Pokémon-Games steht kurz bevor. Nachdem ich eine Regenbogenfeder erhalten, meine Auserwähltheit über die letzten zweieinhalb Tage bewiesen und den rituellen Tanz der Kimono-Frauen verfolgt habe, ist es endlich soweit. Das legendäre Pokémon Ho-Oh erscheint. Ästhetisch ansprechend und mit erheblichen Fähigkeiten ausgestattet, muss ich diesen seltenen Vogel natürlich fangen. Kurz vor dem Beginn des Kampfes noch den Spielstand speichern. Und schon geht es los. Nur um dann genauso schnell wieder zu enden. Nicht, weil ich den feuerspeienden Pfau besiegt habe, sondern weil ich, anstatt Versuch an Versuch zu reihen, lieber die einfache Variante wähle: den Meisterball.
So besonders normale Pokémon erscheinen, es gibt noch eine Steigerung. Sogenannte ‚legendäre Pokémon‘ sind besonders selten, gerade schon singulär. Sie erscheinen genauso phantastisch wie die Monster in anderen Erzählungen, deren Existenz von den Figuren oft bezweifelt und nur in Bildern, Legenden und Artefakten bezeugt wird. Folglich bekommt am Ende lediglich die Gruppe um den Helden Ash diese legendären Pokémon zu sehen, die im Fadenkreuz der Verbrecher stehen. Dass diese nie auf Pokébälle zurückgreifen, liegt in ihrer kriminellen Natur. Aber der Singularitätsstatus der legendären Pokémon lässt sich im Film auch so verstehen, dass sie grundsätzlich nicht mit Pokébällen gefangen werden können. Sie widersetzen sich der Digitalisierung, die der Pokéball darstellt. Denn statt den Pokémon eine eigene Wohnung zu bieten – so hatte ich mir es jedenfalls als Kind immer vorgestellt –, werden sie im Pokéball digitalisiert, d.h. auf ein binäres 0-1-Schema reduziert. Die Singularität der legendären Pokémon besteht dann darin, sich dieser Reduktion zu entziehen, also außerhalb der grundlegendsten Unterscheidung in ihrer natürlichen Lebenswelt zu verbleiben. Sie sind unkultivierbar, ohne gesellschaftsgefährdend zu sein. Eine Art unzähmbare, aber friedliche Natürlichkeit.
In der Taxonomie der Pokémon nehmen sie damit eine ganz besondere Stellung ein. Denn legendäre Pokémon können sich nicht weiterentwickeln. Identitätskontinuität fällt zusammen mit Körperkontinuität, während bei normalen Pokémon ein Geist-Materie-Dualismus um die Ecke blickt. Für diese ist die Entwicklung ein Lebenspotential. Aber sie ist im Gegensatz zur Evolutionstheorie kein historisches Entwicklungsprinzip. Und so entwickelt sich ein Pokémon mal ganz natürlich von der Raupe zum Schmetterling, mal vom Baby zum Ausgewachsenen, mal vom einen in ein sehr anderes Wesen.
Die letzten Schritte bis zum Kampf gegen die Pokémon-Liga erfordern nochmal einiges an Anstrengung. Die Siegesstraße liegt vor mir. Über Stock und Stein durch die raue Natur, die Dunkelhoheit der Höhle. In einer solchen sitzend fühlt sich dabei nicht nur mein Charakter, sondern auch dessen reales Pendant. Nach fast einer Woche Quarantäne würde ich die virtuelle Natur zu gerne gegen ein paar reale Sonnenstrahlen eintauschen. Mithin wäre mir jetzt Pokémon Go lieber als die DS-Edition ‚Heart Gold‘. So ermüdend die Gefangenschaft in den eigenen vier Wände ist, die letzten beiden Tage gilt es zu überstehen und als Pokémon-Meister glorreich abzuschließen.
Als Pokémon Go 2016 erschien, war der Hype surreal. Selbst als frischgebackene Abiturienten verbrachten wir manche Abende am Bodensee mit Bier und Smartphone, um dann später mit dem Fahrrad, natürlich unterhalb der Promillegrenze, in den Weiten der Kleinstadt Pokémon abzugrasen. Nicht nur wir wurden dadurch zur Bewegung animiert. Eine Studie zeigt, dass Pokémon Go alle Bevölkerungsgruppen hierzu motivierte, und das effektiver als so ziemlich jede Gesundheitsapp.11 Besonders war das Game, weil es mit der Zurückgezogenheit und Außergewöhnlichkeit des Spiels brach. Das heißt nicht, dass Pokémon Go sozial oder gar kooperativ gespielt werden musste (der Kampf gegen andere Spieler war ohnehin nicht möglich). Aber Gaming trat in den öffentlichen und alltäglichen Raum.
Das ist letztlich nicht spezifisch für Pokémon Go und liegt auch weniger am Game selbst als an dessen materiellen Voraussetzungen. Ohne Smartphones ist solches Gaming nämlich undenkbar. Auch normale Handyspiele können genauso wie Pokémon Go im öffentlichen Raum gespielt werden. Und wer als Kind in den Urlaub fuhr und einen Gameboy dabei hatte, spielte oft im Auto bis zur Übelkeit und am Strand bis zum Sonnenbrand. Dass menschliche Aktivitäten delokalisiert werden, vom Arbeitsplatz ins Homeoffice, vom Desktop-PC zum kleinen Lebensbegleiter, ist kennzeichnend für die Digitalisierung, kulminiert im Smartphone, bahnte sich aber schon mit anderen tragbaren Konsolen an. Das Spezifikum Pokémon Gos ist vielmehr, dass das Game nur draußen in der Welt gespielt werden kann. Mit dem Smartphone oder Gameboy kann man auch zuhause spielen, wer aber vom Sofa aus die Pokémon Go-Welt erobern will, ist zum Scheitern verurteilt. In der Augmented Reality verschmelzen reale und digitale Welt. Vorläufer hierfür war schon der Pokéwalker, der Pokémon aus dem Game an der Gürtelschnalle mit auf den Sportplatz brachte und es ermöglichte, sie mit realen Schritten zu trainieren. Pokémon Go hat dieses Prinzip nun radikalisiert. Und so ist dieser Bezug zur Realität auch der zentrale Unterschied zu anderen Computerspielen. Ersetzen diese Realität oft und drängen das ‚real life‘ zurück, infiltriert Pokémon Go den Alltag und integriert sich ins normale Leben.
Mein normales Leben habe ich nach über einer Woche Quarantäne endlich zurück. Ich könnte mich jetzt offiziell Pokémon-Meister nennen, aber derart verwoben sind die alten Pokémon-Games dann doch nicht mit der Welt da draußen. Den Eintrag in die Ruhmeshalle, nachdem ich Siegfried, den Champion der Top-Vier und Drachenbändiger (nicht -töter!), bravourös besiegt habe, nehme ich trotzdem entgegen. Mein Team entlasse ich in den wohlverdienten Ruhestand, während ich zur Arbeit unter gleißenden Sonnenstrahlen an die Universität fahre. Dabei fällt mir im Konstanzer Paradies ein kleines Café auf, in dem ich vor ein paar Jahren nach einer verzechten Nacht mit Freunden frühstückte. Damals kamen wir aus dem Staunen nicht heraus, als sich uns gegenüber auf der anderen Seite der Straßenkreuzung, unter einer Laterne, eine Ansammlung von Menschen zu bilden begann. Jung und Alt gleichermaßen. An die sechs Personen standen dort und starrten auf ihre Handys. Niemand sprach ein Wort. Wir rätselten: Ist das eine Gruppe von Touris? Ein verunglücktes Familientreffen? Eine versteckte Bushaltestelle? Eine Reise nach Narnia?, kamen aber auf keine Lösung, was uns stärkeres Kopfzerbrechen bereitete als der hart erarbeitete Kater. Dessen Gegenspieler, der Pudel, sprang erst nach einer Viertelstunde auf den Tisch: Die heterogene Gruppe spielte Pokémon Go. Und sie war gerade darin begriffen, aufzubrechen. Fasziniert blickten wir den Leuten hinterher, die sich, ohne ein Wort miteinander gewechselt zu haben, wieder in alle Himmelsrichtungen verflüchtigten. Noch etwas desorientiert, wendeten wir uns wieder dem Frühstück zu, ohne ein leichtes Schmunzeln unterdrücken zu können. Ob des Erlebnisses oder doch unserer Unfähigkeit wegen, das Offensichtliche gleich zu erkennen? Unbeantwortbar. Aber es zeigte sich einmal mehr: Pokémon bewegt die Jungen, die Junggebliebenen – und die jüngst Verkaterten.
- Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, übers. von in engster Zusammenarbeit mit dem Verfasser aus dem Niederländischen übersetzt von Hans Nachod, Reinbek bei Hamburg 1987 (rohwolts enzyklopädie 435), S. 15.
- Besonders eindrücklich hierzu die Folge ‚The Science and Politics of Pokemon Battles, Part 2‘ des Podcast ‚Silp Radio. A Pokemon Podcast‘, die exemplarisch zwischen analytischer Theoriebildung und abstruser Spekulation schwankt.
- Vgl. Gundolf S. Freyermuth: Games – Game Design – Game Studies. Eine Einführung, Bielefeld 2015, S. 189-192.
- Vgl. Jason Bainbridge: ‚It is a Pokémon world‘. The Pokémon franchise and the environment, in: International Journal of Cultural Studies 17 (2014), S. 399–414, hier S. 404-408.
- Vgl. John Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung, übers. von Hans Jörn Hoffmann, 4. Aufl., Frankfurt a. M. 1989 (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 213), II 27, S. 216f.
- Bainbridge (Anm. 4), S. 406 spricht davon, dass Pokémon und der Trainer am Ende ein gemeinsames Ziel („purpose“) haben und zu einer ‚Symbiose‘ kommen.
- Vgl. Claus-Peter H. Ernst und Alexander W. Ernst: Why People Play Pokémon. The Role of Perceived Belonging, in: Twenty-first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico 2015.
- Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur, in: Texte zur Kulturtheorie und Kulturwissenschaft, hg. von Roland Borgards, Stuttgart 2010 (Reclams Universal-Bibliothek 18715), S. 98–110, hier S. 110.
- Vgl. Michael Dylan Foster: Pandemonium and Parade. Japanese Monsters and the Culture of Yōkai, Berkeley/Los Angeles/London 2009, S. 213-215.
- Vgl. ebd., S. 214.
- Vgl. Tim Althoff [u.a.]: Influence of Pokemon Go on Physical Activity. Study and Implications, in: Journal of Medical Internet Research 18 (2016).
